Düsseldorf, 31. Januar 2025
Grenzen des guten Geschmacks. Was darf Werbung eigentlich noch?
In der Werbung ist alles erlaubt. Stimmt nicht! Zwischen Stereotypen und vermeintlicher Diskriminierung, Jugendschutz und Rügen vom Deutschen Werberat entbrennen regelmäßig Diskussionen über die Grenzen des Erlaubten. Wie schmal ist der Grat zwischen treffsicher und total daneben?
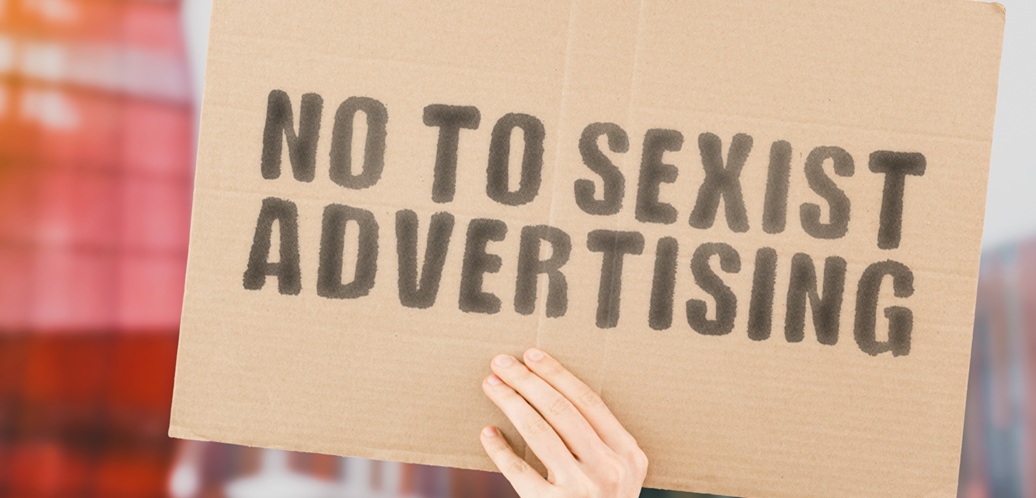
Gute Werbung berührt. Sie ist emotional, intelligent und spricht eine Zielgruppe. Sie darf provozieren – sollte es aber mit Fingerspitzengefühl tun. Denn nicht immer kommt das, was vermeintlich gut gedacht ist, auch gut an. Erst recht nicht, wenn es sich spätestens beim zweiten Blick als geschmacklos erweist. So wie der Aufdruck auf dem Lieferwagen eines Händlers für Gartengeräte aus Würzburg, der eine Frau in Unterwäsche neben einem Rasenmäher zeigte, dazu der Slogan: „Wir schneiden immer scharf ab“. Oder die Anzeige eines Landtechnik-Händlers in einer Lokalzeitung, der seine Geräte mit dem Bild einer Frau bewarb, deren Sommerkleid von einem Laubbläser hochgeblasen wurde, sowie der Zeile: „Die schönste Seite des Herbstes. Erleben Sie sie mit Laubsaugern und -bläsern. Wir finden auch für Sie das passende Gerät.“
Was beide Kampagnen verbindet? Sie bedienen sich simpler Klischees, schießen über ihr Ziel hinaus und ernten statt Aufmerksamkeit vor allem Kopfschütteln. In beiden Fällen wurde der Deutsche Werberat (DWR) angerufen. Seit inzwischen 50 Jahren kann sich jeder bei diesem Gremium melden, der Werbung als diskriminierend, unpassend oder problematisch wahrnimmt. Der Rat als Selbstkontrolleinrichtung des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft prüft Motive und Slogans, die zwar juristisch zulässig sind, aber ethische Grenzen überschreiten könnten – und fordert bei Bedarf dazu auf, die Werbung einzustellen oder zu ändern. Passiert das nicht, kann er eine öffentliche Rüge aussprechen und die Grenzüberschreitung publik machen. So geschehen in den zwei beschriebenen Fällen.
Diskriminierung und Gewalt sind tabu
Im ersten Halbjahr 2024 hat der Deutsche Werberat 182 Beschwerden bearbeitet. Das mag angesichts der Flut von Kampagnen, Motiven, Slogans uns sonstigen Werbemaßnahmen, mit der Unternehmen und Agenturen um die Aufmerksamkeit von Kunden buhlen, marginal erscheinen. Dennoch vermittelt die Statistik einen Eindruck der Schwachstellen der deutschen Werbelandschaft. Mehr als die Hälfte der Beschwerden betrafen Geschlechterdiskriminierung, Diskriminierung von Personengruppen oder sexuell anstößige Werbung. Weitere Gründe waren etische und moralische Bedenken, Gewaltverherrlichung, die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen, Tierschutzbedenken und die Verletzung religiöser Gefühle. 29 Kampagnen identifizierte der Rat tatsächlich als ethisch fragwürdig und ließ sie stoppen, ändern oder erteilte eine Rüge.
Werbeverbote bewirken wenig
Besonders kontrovers sind auch Kampagnen, die Kinder und Jugendliche ansprechen. Dass Werbung für Produkte wie Tabak, Alkohol, Glücksspiel und Co. im Umfeld von Kindern verboten ist, regeln der Jugendschutz und andere Gesetze. Darüber hinaus gibt es allerdings auch hohe moralische Erwartungen an Werbung mit Kindern und an Kinder. Sie sind leichtgläubig, naiv und unerfahren, was nicht ausgenutzt werden darf. Allerdings treibt die Kritik an Kinderwerbung bisweilen auch merkwürdige Blüten, etwa wenn es um zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel geht und Werbung pauschal dafür verantwortlich gemacht wird, dass gut 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig sind.
Anfang 2023 sorgte Cem Özdemir als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Vorschlag eines Werbeverbots für ungesunde Lebensmittel für Aufsehen. Produkte mit viel Zucker, Fett und Salz sollten wochentags zwischen 17 und 22 Uhr im Fernsehen und online nicht mehr zu sehen sein. Weitere Einschränkungen waren für Wochenenden geplant. Außerdem sollte es eine Bannmeile für Plakatwerbung rund um Kitas und Schulen geben. Inzwischen liegt das Vorhaben wieder auf Eis, doch die Diskussion, die es hervorgerufen hat, hallt noch nach.
Wie weit reicht die Verantwortung?
„Natürlich hat die Industrie ein hohes Maß an Verantwortung“ räumt Katja Heintschel von Heinegg, Geschäftsführerin des Deutschen Werberats, in einem Artikel der absatzwirtschaft ein, „aber nicht das Maß, dass die Politik ihr zuschreibt.“ Die Lebensmittel- und Werbebranche argumentiert vielmehr, dass nicht das Marketing das Problem sei, sondern das Verhalten der Verbraucher. Studien in anderen Ländern mit Werbeverboten, etwa in Chile, haben gezeigt, dass dort zwar weniger zucker- und fetthaltige Produkte gekauft werden, die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen jedoch nicht sinkt – weil sie stattdessen andere ungesunde Lebensmittel essen.
Das führt zurück zur Frage: Welche Aufgabe hat Werbung? Aus Unternehmenssicht soll sie den Verkauf fördern. Aus gesellschaftlicher Sicht prägt sie die Kultur und hilft dabei Medien und Meinungsvielfalt zu finanzieren. Und aus Verbrauchersicht? Sollte sie mehr informieren und weniger verführen? Immerhin werden Kaufentscheidungen nur zu gut 20 Prozent rational getroffen und zu 80 Prozent emotional und unbewusst. Genau auf diese 80 Prozent zielt Werbung in der Regel ab, damit sie erfolgreich ist. Ignorieren darf die Branche die Diskussion um respektvolle und verantwortungsbewusste Werbung jedoch auch nicht – und sie tut es auch nicht, wie die jüngste DWR-Statistik zeigt. Die Zahl der dort eingehenden Beschwerden ist seit Jahren rückläufig. Die Experten schließen daraus, dass Werbetreibende durchaus verantwortungsvoller und sensibler in Bezug auf die Nebenwirkungen ihrer Kampagnen und Botschaften werden.
Wie schätzen Expert*innen die aktuelle Stimmung in der Marketingbranche ein?
Unser BVMC-ifo Marketing-Barometer gibt Auskunft.
